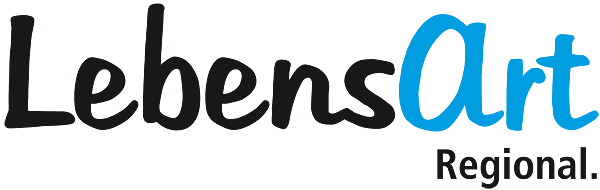Kirchhellen - EP, Q1, Q2, G8, G9 – Wer sich momentan mit dem Thema gymnasiale Oberstufe beschäftigt, kommt leicht ins Schlingern angesichts der seltsamen Abkürzungen, der doppelten Bedingungen und praktischen Komplikationen (s. Kasten). Mit den Abiturprüfungen im April geht in diesem Jahr eine aufreibende Zeit des Übergangs und der Umstellung zu Ende. Der doppelte Abiturjahrgang 2013 ist schon etwas Besonderes – auch am Vestischen Gymnasium in Kirchhellen.

Statt im Schnitt 70 Schülerinnen und Schüler gilt es hier nun, 109 Abiturienten durch die Reifeprüfung zu bringen. Schulleiter Matthias Plaputta gibt sich aber zuversichtlich. Die Leistungsunterschiede seien nun ausgemerzt, das Niveau angeglichen. Trotzdem: Die Entscheidung der NRW-Landesregierung, die Zeit bis zum Abitur auf 8 Jahre zu reduzieren (G8), hatte ihren Preis. 21 Schülerinnen und Schüler – weit mehr als üblich – haben das VGK vor dem Abitur verlassen. „Die Schulzeitverkürzung ist eine Belastung für die Schüler“, sagt Oberstufenkoordinator Oliver Schulte ganz offen. „Die Lehrer müssen das wissen und bei Bedarf ihren Unterricht beispielsweise durch neue Methoden umgestalten. Gleichzeitig darf aber das Niveau nicht darunter leiden.“ Eine schwierige Gratwanderung für das Kollegium, das zudem mit zwar gekürzten, aber nicht unbedingt vollends entschlackten Lehrplänen zu kämpfen hat. „Wir müssen viel Stoff meist sehr komprimiert an die Schüler bringen“, erläutert Beate Bomholt, Stufenleiterin der G9-Abiturienten im Gespräch mit LebensArt. Die Lehrer bestätigen einen gestiegenen Leistungsdruck unter den Schülern, der bereits in Klasse 5 beginnt. „Die Schere geht immer weiter auf. Wir finden viele Schüler im sehr guten Bereich – genauso aber im sehr schlechten.“
Was bedeuten die Abkürzungen?
G8 hat nichts mit Politik zu tun, sondern bedeutet achtjähriges Gymnasium, G9 entsprechend neunjähriges Gymnasium. EP ist die Abkürzung für Einführungsphase. Für G8-Schüler ist das die zehnte Klasse, für die letzten G9-Schüler war es die elfte Jahrgangsstufe. Hier wurde der doppelte Jahrgang das erste Mal zusammengeführt. Das „Q“ steht für Qualifikationsphase. Die letzten zwei Jahre der Oberstufe werden also nicht mehr – bei G9 – 12 und 13 oder – bei G8 – 11 und 12 genannt, sondern Q1 und Q2.
Doppelter Jahrgang – eine Herausforderung
Vor allem in der Phase der Zusammenführung der beiden Stufen waren Entwicklungs- und Leistungsunterschiede feststellbar. „Nicht bei allen, aber bei einigen der G8-Schüler war durchaus zu erkennen, dass ihnen mit dem ‚fehlenden‘ Jahr eine gewisse Lebenserfahrung fehlt und dass sie dadurch ein Stückweit weniger Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess übernommen haben“, erläutert Matthias Plaputta. Doch mit der Zeit habe sich das relativiert, so die Lehrer einstimmig. „Ich weiß häufig schon gar nicht mehr, ob ein Schüler G8 oder G9 ist“, sagt Beate Bomholt. Das ist auch dem ständigen Dialog mit den Schülern (und Eltern) und der individuellen Betreuung zu verdanken. Wenn es Probleme gibt, stehen den Schülern mit Beate Bomholt und Marc Heib gleich zwei Stufenleiter zur Seite, die jederzeit ansprechbar sind. Zu Beginn hat man eigens einen Runden Tisch ins Leben gerufen, der inzwischen mangels Bedarf wieder eingestellt wurde. „Wir haben einfach gemerkt, dass sich die Schüler gegenseitig unterstützen. Die älteren helfen den jüngeren und umgekehrt“, sagt Matthias Plaputta. Das bestätigen auch die Schüler. Probleme, die explizit mit dem doppelten Abijahrgang zusammenhängen, kennen sie nicht, da sind sich die Stufensprecher Victoria Friedhoff (G8) und Benedikt Ebing (G9) einig. Auch die Abiturfeierlichkeiten werden gemeinsam organisiert. Nur bei der Frage des Alters stoßen vor allem die G8-Schüler an ihre Grenzen. „Mit 17 darf man ja nichts unterschreiben und auch nicht mal eben ins Auto steigen und Besorgungen, beispielsweise für den Kiosk, erledigen“, berichtet Benedikt Ebing. Bei der Organisation der Räumlichkeiten für den Abi-Ball haben sich daher Elternvertreter und Lehrer gemeinsam die Örtlichkeit angeschaut und gebucht. Erstmals in diesem Jahr reicht das Brauhaus nicht zum Feiern aus. Man muss ins benachbarte Gladbeck auswandern. „Aber auch hier mussten wir schon vor zwei Jahren alles fest zusagen. Die größeren Veranstaltungsorte können sich vor Anfragen nicht retten“, weiß Beate Bomholt. Während also die größeren Gymnasien gar in den Westfalenhallen oder in Düsseldorf feiern müssen, ist es für das VGK wenigstens noch bei der Nachbarstadt geblieben.
Schule rückt noch mehr in den Alltag
Die Umstellung von 9 auf 8 Jahre bis zum Abitur hat den Alltag der Schülerinnen und Schüler enorm verändert. Es ist viel diskutiert worden, ob nun das Burnout-Syndrom auch an Schulen droht oder die Schulzeitverkürzung lediglich ein Luxusproblem darstellt. Fakt ist, die Unterrichtszeiten sind länger geworden. Schon in der Sekundarstufe 1 müssen die Schüler zweimal in der Woche bis etwa 16 Uhr bleiben. In der Oberstufe stehen 34 Wochenstunden an – Hausaufgaben, Aufwände für Fremdsprachen und Lernphasen nicht mit eingerechnet. „Man ist nach der Schule häufig müde und kaputt“, gibt Victoria Friedhoff zu. Die Stufensprecherin wird als eine der ersten in diesem Jahr nach acht Jahren das Abitur machen. Sie ist eine gute Schülerin, doch die eingeschränkte Freizeit hat auch bei ihr Spuren hinterlassen. Zwar musste sie das Reiten nicht aufgeben, aber für mehrtägige Turniere und intensives Training fehlt einfach die Zeit. Dem kann Anne Husmann aus dem Jahrgang darunter nur zustimmen. „Ich spiele Tennis, aber oft schaffe ich es nur knapp zum Training. Entweder habe ich lange Schule oder es warten Vokabeln und Hausaufgaben.“ Den veränderten Alltag von G8-Schülern bekommen die Sportvereine und Musikschulen deutlich zu spüren. Die Zahl der Kinder, die in ihrer Freizeit noch genügend Zeit für Reisport, Tanzen, Leichtathletik und Fußball haben, sinkt. Auch das AG-Angebot der Schule leidet. „Überhaupt mussten wir feststellen, dass die Schüler außerschulische Aktivitäten und auch freiwillige Aktionen, die die Schule betreffen, immer öfter aufgrund der Arbeitsbelastung absagen“, sagt Matthias Plaputta.
Was kommt nach dem Abitur?
Am Vestischen Gymnasium wird bereits frühzeitig zu Beruf und Studium informiert. Von Berufsinfotag und Berufsnavigator über Fahrten zu den Universitäten Münster und Essen bis hin zu Beratungsterminen mit der Agentur für Arbeit und Assessment-Center-Trainings reicht das Angebot der Schule – auch das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre. Schule ist heute weit mehr als eine bloße Lehr- und Lernanstalt, sie gibt Impulse für einen guten Start in die berufliche Zukunft. Doch trotz aller Beratung: Die jungen Menschen scheinen heute mehr denn je von Angst und Unsicherheit geprägt zu sein. Wo bleibe ich, wenn laut Prognose des NRW-Schulministeriums rund 45.000 mehr Studienberechtigte an die Universitäten drängen? Die meisten beantworten die Frage so: ich gehe erst einmal ins Ausland. Ob 17 oder 19 – das Jahr nach dem Abitur wird bei vielen jungen Menschen als Entwicklungs- und Findungsphase empfunden. „Man gewinnt dieses Jahr nicht, weil man es sowieso anders nutzt“, findet Victoria Friedhoff. Aus ihrem Umfeld weiß sie, dass die meisten nicht direkt an die Uni oder in die Ausbildung wollen. Work & Travel, Aupair oder Jobben sind da eher angesagt. „Wir wissen ja, dass jetzt fast doppelt so viele Abiturienten auf den Markt geschwemmt werden“, sagt Benedikt Ebing, der noch 13 Jahre bis zum Abi die Schulbank drücken musste. Auch er sieht die Zeit nach dem Abschluss als Chance, einmal etwas völlig Neues zu erleben. „Wann kann man sonst jemals wieder ein Jahr ‚Pause‘ machen?“ js