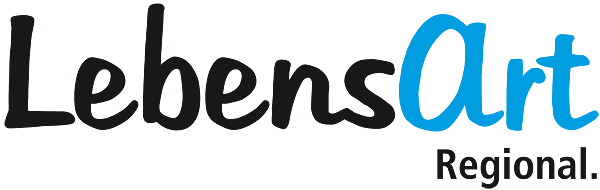Kirchhellen - Die Kirche St. Mariä Himmelfahrt Kirche in Feldhausen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bis im Jahr 1460 lassen sich die Spuren der damaligen Kapelle zurückverfolgen. Auch heute finden sich noch viele alte Schätze in der katholischen Kirche. Jedes der Relikte erzählt seine eigene Geschichte und lässt uns heute eine spannende Reise in die Vergangenheit unternehmen. Gemeinsam mit dem Verein für Orts- und Heimatkunde stellen wir die Kunstwerke und die Kirchengeschichte vor.

Foto: Katharina Boll
Den dörflich-idyllischen Charakter hat sich Feldhausen bis heute bewahrt. Mittelpunkt des Ortes bildet die denkmalgeschützte Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Wenn wir auf die Entstehung der Kirche zurückblicken, schauen wir ebenfalls auf die Geschichte der Adelsfamilie Beke. In einer Kurzbeschreibung aus Anlass des diesjährigen Kirchhellentages des Vereins „Natürlich Kirchhellen“ berichtet die Kunsthistorikerin Dominique Leichtfuss Interessantes zur Kirchengeschichte und besonders hervorzuhebende Kunstwerke in der heutigen Kirche. Im 13. Jahrhundert erscheint erstmals in den Xantenschen Registern das Adelsgut „tor Beke“. Das Haus Beck ist heute besser bekannt als Schloss Beck. Johann von der Beke und seine Frau Elsa sind die Stifter der „Vicarie Beatae Maria Virginae“. 1463 wurde die Vikarie gestiftet. Aus den Stiftungsurkunden ist zu entnehmen, dass die gleichnamige Kapelle zu diesem Zeitpunkt bereits erbaut wurde. Es ist belegt, dass am 4. März 1473 die Stiftung durch die erzbischöfliche Behörde in Köln bestätigt wurde. Johann von der Beke ließ die Kapelle erbauen, da sein Haus Beck keine eigene Hauskapelle besaß. Sie diente der Adelsfamilie ebenfalls als Begräbniskapelle. Die Gräber wurden durch Bronzeplatten gekennzeichnet. Vier der wertvollen Platten sind noch heute erhalten und sind in dem Boden des Chores eingelassen. „In den vergangenen fünf Jahrhunderten wurde die Kirche St. Mariä Himmelfahrt mehrfach umgebaut und erweitert“, erklärt Hermann Gahlen, Mitglied des Kirchenvorstandes und Vorsitzender des Bauausschusses der Pfarrgemeinde. Der Chor der heutigen Kirche entspricht der ursprünglichen Kapelle. Wer heute die Kirche besichtigt, kann hier sogar noch unschwer ursprüngliches Mauerwerk erkennen. Mittig hinter dem Altar hängt das Kruzifix aus der Zeit um 1500. Eingerahmt wird der Gekreuzigte von zwei spätgotischen Glasfenstern, die um 1485 von Johann von der Bekes Enkelin gestiftet wurden. Seit 1899 unterlagen die wertvollen Glasfenster mehreren Aus- und Umbauten, sowie zahlreichen Restaurierungen. Ein weiteres wichtiges Relikt wurde lange Zeit unbedacht in der Sakristei aufbewahrt. Die Kreuzreliquie erhielt erst im Jahr 1963 einen Ehrenplatz in der Kirche, nachdem der damalige Pfarrer Wilde im Pfarrarchiv eine Urkunde des Bischofs von Siena fand, die die Echtheit der Reliquie bestätigt. 1734 kam das wertvolle Kreuz in den Besitz der Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Um 1660 erfuhr die Kirche eine erste Erweiterung um ein 3,50 Meter langes Westjoch. 1884 kam es zu einem weiteren Ausbau von St. Mariä Himmelfahrt. Es erfolgte eine erhebliche Vergrößerung im Neugotischen Stil. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde die Kirche durch Bomben zerstört, so dass sie für Gottesdienste nicht mehr zur Verfügung stand. Diese fanden in einer Notkiche neben der zerstörten Kirche statt. Erst Anfang der 1950er Jahre erfolgte unter Pastor Heinrich Ohmen der Wiederaufbau der Kirche in Feldhausen. „Auch in den vergangenen vier Jahren gab es unbedingt notwendige Baumaßnahmen“, erzählt Hermann Gahlen. Mauerwerke aus dem 15. und 18. Jahrhundert wurden aufwendig restauriert und auch die wertvollen Glasfenster wurden mit Sicherheitsglas vor Beschädigungen geschützt. Außerdem erhielt ein Teil der Kirche eine neue Beleuchtung. „Wir sind dankbar, dass es möglich war, die kostspieligen, aber notwendigen Sanierungen von vielen Verantwortlichen der Verwaltung des Bistum und der Denkmalbehörde genehmigt zu bekommen“, freut sich Hermann Gahlen. Er bedankt sich ebenfalls bei dem Kirchenvorstand und dem Architekturbüro, die diese Arbeiten begleitet haben. kb