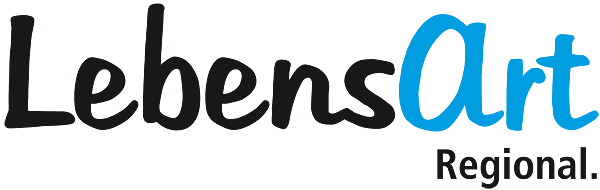Der Gladbecker Priester und Kirchenhistoriker Ralph Eberhard Brachthäuser präsentiert nun im ersten Band eine Sammlung von Artikeln aus der Gladbecker (Volks-)Zeitung der 1930er Jahre, die rückblickend die Ereignisse der Ruhrbesetzung detailliert darstellen. Lebensart hat mit Pfarrer Brachthäuser über die Zeit des Ruhrkriegs gesprochen:
Pfarrer Brachthäuser, was weiß man über den Ruhrkrieg hier in Gladbeck?
Zunächst muss man sagen, dass der etwas martialisch klingende Begriff „Ruhrkrieg“ nur einer von vielen für die damalige Besatzungszeit ist, der seinerzeit allerdings in allen politischen Lagern so verwendet wurde. Selbst im Französischen wurde lange vom „guerre de la Ruhr“ gesprochen. In der Gladbecker Geschichtsschreibung kommt diese Zeit allerdings kaum vor, obwohl sie sich damals ins kollektive Gedächtnis damals eingebrannt hatte. Zwei Jahrzehnte waren diese Ereignisse bei den Menschen vorherrschend, bis sie vom 2. Weltkrieg abgelöst wurden. Daher war es mir wichtig, auf diese Zeit hinzuweisen. Deshalb die beiden Bände, von denen der zweite im Spätherbst erscheint. Sie bilden eine unverzichtbare Quellensammlung für alle, die sich mit der Gladbecker Stadtgeschichte auseinandersetzen möchten, denn es gibt heutzutage kaum noch Zeitungen aus der Besatzungszeit. Im Januar 1933, also noch vor der NS-Zeit, schrieb der Chefredakteur der Gladbecker Zeitung, der schon 1923 dort tätig war, Artikel auch aufgrund der eigenen Erlebnisse. Ergänzt wird die Sammlung durch Beiträge aus anderen Zeitungen, die in den 1930er Jahren in Gladbeck gelesen wurden, die jedoch weniger Zeit-Zeugnis sind als vielmehr den ideologischen Zeit-Geist des Dritten Reiches widerspiegeln.
Warum besetzten die Belgier und Franzosen das Ruhrgebiet?
Der Einmarsch war eine Folge des verlorenen Ersten Weltkriegs und der erheblichen Reparationszahlungen, die durch den Vertrag von Versailles gefordert wurden. Frankreich kritisierte früh die angebliche Nichterfüllung dieser Forderungen und drohte mit der militärischen Besetzung des rheinisch-westfälischen Industriegebiets. Der unmittelbare Anlass dafür war 1922 der Vorwurf, dass Kohle- und Telegrafenmastlieferungen unterlassen wurden. Daraufhin marschierten die Truppen ins Ruhrgebiet ein.
Wie viele belgische Soldaten befanden sich damals in Gladbeck und wo waren sie untergebracht?
Im Jahr 1923 waren bis zu 4000 Soldaten in Gladbeck stationiert, ergänzt durch etwa 100 Offiziere und bis zu 500 Zivilangestellte. Viele Schulen im Stadtgebiet dienten damals als Unterkünfte, einschließlich der Aloysiusschule an der heutigen Postallee, ehemals Mühlenstraße, und des Mädchenlyseums gegenüber dem Rathaus an der Viktoriastraße. Die Offiziere wurden in den vornehmeren Bürgerhäusern untergebracht. Der kommandierende Oberst bezog die Villa Küster an der Gustavstraße 10, die auf zwei Etagen jeweils 260 Quadratmeter Wohnfläche bot, während die eigentlichen Bewohner sich mit wenigen Zimmern zufriedengeben mussten.
Welche Auswirkungen gab es in dieser Zeit
Jegliche Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten wurde abgelehnt. Die Bergarbeiter stellten den Betrieb ein und die Lokführer verließen ihre Züge. Dies führte zu Schwierigkeiten und Unfällen bei Belgiern und Franzosen, die mit den Lokomotiven und vor allem dem komplexen Schienennetz des Ruhrgebietes nicht vertraut waren. Immer mehr Arbeiter traten in den Ausstand. Sie wurden während dieser Zeit von der Reichsregierung bezahlt, was bedeutete, dass mehr Geld gedruckt werden musste, um die vielen Zahlungen zu leisten. Letztendlich führte dies zur Inflation, und das Geld verlor seinen Wert. Eine Million Reichsmark für ein Brot war damals üblich. Die Versorgungssituation in der Stadt verschlechterte sich zusehends. Die Kokereien waren geschlossen, was die Gasversorgung lahmlegte. Öfen, Straßenlaternen und vieles mehr konnten nicht mehr betrieben werden. Darüber hinaus wurden fast alle führenden Köpfe der Stadtverwaltung, einschließlich des Oberbürgermeisters, ausgewiesen, sodass Gladbeck nahezu führungslos war. Täglich drohten weitere Verhaftungen und Ausweisungen.
Wie verhielten sich die Besatzer?
Die Besatzer verübten insbesondere im Jahr 1923 zahlreiche Gewaltakte. Beschlagnahmungen von Eigentum, Körperverletzungen und Vergewaltigungen waren für die Bürger Gladbecks an der Tagesordnung. In Gladbeck führten Übergriffe auch zu vier Todesfällen. Ein 16-jähriger Gladbecker erlag den Folgen einer Dolchstichverletzung an der in die Schläfe, die ihm ein Soldat in Gelsenkirchen-Horst zugefügt hatte. Zusätzlich verhängten die belgischen und französischen Militärgerichte harte Strafen. Glücklicherweise wurden keine Gladbecker zum Tode verurteilt. Die damals üblichen Ausweisungen von Politikern und Werksdirektoren führten bei vielen großen Industriebetrieben zu erheblichen Problemen.
Wer sich eingehender mit dieser herausfordernden Periode der jüngeren Geschichte Gladbecks beschäftigen möchte, findet in diesen beiden Bänden eine unerlässliche Sammlung von Quellen. Sie sind für jeden unentbehrlich, der sich mit der Stadtgeschichte Gladbecks auseinandersetzt.
Erhältlich ist der erste Band bei der Humboldt-Bücherei auf der Postallee, in der Gladbecker Information im Alten Rathaus und im Stiftshaus Gladbeck, Kontakt unter post@stiftshaus.de.

Pfarrer Ralph Eberhard Brachthäuser
Brachthäuser, geboren 1962 in Dortmund, wuchs in Mülheim auf. Nach dem Theologiestudium mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte weihte ihn Kardinal Hengsbach 1990 zum Priester. Er amtierte von 1998 bis 2010 als Pfarrer der Gemeinde „Heilig Kreuz“ in Butendorf sowie einige Jahre als Klinikseelsorger in Essen-Steele und Essen-Altenessen. Brachthäuser lebt in Gladbeck und gründete die "Pfarrer-Brachthäuser-Stiftung", welche die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Denkmalschutz, Heimatpflege sowie Kunst und Kultur fördert. Er ist Autor historischer und kirchengeschichtlicher Essays und Studien.